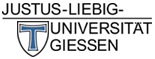Spotlight Forschung: "PARTITUR: Biologische und physikalische Optimierung der Partikelstrahlen - Strahlenschutz für den Patienten"
Was wollen Sie mit dem Projekt erreichen?
Das wissenschaftliche Ziel unseres Vorhabens ist die Erarbeitung grundlegender strahlenbiologischer und strahlenphysikalischer Daten und Methoden sowie die Entwicklung neuer Technologien für die Partikeltherapie mit Kohlenstoff-Ionen, die erforderlich sind, um die Therapie thorakaler Tumoren mittels dieser Strahlenart entscheidend zu verbessern. Das nicht-kleinzellige Lungenkarzinom (NSCLC) ist in Deutschland die häufigste Krebstodesursache. Die sehr schlechte Prognose beruht vor allem darauf, dass dieser Tumor mit den derzeitigen Therapien nur sehr eingeschränkt behandelt werden kann. Ursache dafür ist zum einen die Therapieresistenz des Tumors, zum anderen die Einschränkung der Therapie durch die hohe Empfindlichkeit der gesunden Lunge sowie der angrenzenden Organe. Mit den strahlenbiologischen Untersuchungen soll geklärt werden, welche Wirkung die Kohlenstoff-Bestrahlung auf Tumor und Normalgewebe hat und wie negative Auswirkungen der Bestrahlung zum Schutz des Patienten minimiert werden können.
Welche Auswirkungen hat das Projekt auf die Forschung und Gesellschaft bzw. wie kann die Gesellschaft von Ihrem Projekt profitieren?
Die strahlentherapeutische Behandlung mit Kohlenstoff-Ionen wird bislang nur für eine begrenzte Zahl von Patienten eingesetzt. Dies liegt zum einen an der geringen Zahl von Zentren in Deutschland und Europa, die diese Therapiemodalität anbieten können. Zum anderen aber auch an der Tatsache, dass für einige Tumorentitäten grundlegende strahlenbiologische Daten als Voraussetzung für die erfolgreichen Behandlung fehlen. Für das Bronchialkarzinom, dass in Europa die Krebserkrankung mit der höchsten Mortalität ist, wollen wir diese Daten erarbeiten.
Darüber hinaus soll die Bestrahlungstechnik mit Hilfe von 3D-Reichweitenmodulation weiterentwickelt werden. Wie Projektkoordinator Prof. Dr. Klemens Zink erläutert: „Der große Vorteil des von uns eingesetzten 3D-Reichweitenmodulators ist, dass wir damit die Strahlendosis extrem genau an das Tumorvolumen anpassen können. Zusätzlich können wir dadurch gleichzeitig auch sehr schnell bestrahlen.“ Hintergrund dafür ist die Tatsache, dass sich Lungentumore mit der Atmung des Patienten bewegen. Damit muss bei der herkömmlichen Therapie zwangsläufig ein größeres Volumen bestrahlt werden, so dass sichergestellt ist, dass der Tumor in allen Atemphasen eine ausreichende Dosis erhält.
Mit der neuen Bestrahlungstechnik, welche die Forschenden im Rahmen des PARTITUR-Projekts entwickeln, kann die Bestrahlungszeit von derzeit rund 5 - 10 Minuten auf einige Sekunden reduziert werden. „Das ist dann selbst für Patienten mit einem Lungentumor durchaus ein Bestrahlungszeitraum, um die Luft anhalten zu können und dann haben wir keine atembedingte Bewegung des Tumors mehr,“ ergänzt Dr. Baumann. Dies hat zur Folge, dass das gesunde Lungengewebe deutlich besser geschont und damit die Nebenwirkungen minimiert werden können.
Der gesellschaftliche Impact ist also darauf ausgerichtet, die Behandlungsoptionen für Lungenkarzinome in den nächsten Jahren deutlich zu verbessern.
Worin sehen Sie den besonderen Nutzen in der hochschulübergreifenden Zusammenarbeit? Was ist das Besondere an Ihrem Projektteam?
An dem Projekt sind alle Partner des FCMH (Philipps-Universität Marburg, Justus-Liebig-Universität Gießen, Technischen Hochschule Mittelhessen) sowie die Abteilung Biophysik des GSI-Helmholtzzentrums Darmstadt und das Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf beteiligt. Alle Partner haben eine komplementäre Expertise die sie in das Projekt einbringen: Strahlenbiologie, Biophysik, Medizinische Physik und Engineering. Für eine einzelne Universität oder Hochschule wäre das Projekt nicht durchführbar gewesen.
Die große Herausforderung besteht Dr. Baumann zufolge darin „[…] die Ergebnisse interdisziplinär zusammenzubringen. Aus diesem Grund haben wir unser Konzept mit regelmäßigen Retreats, Symposia und Summer Schools entwickelt. Im Rahmen dieser Veranstaltungen, bei denen dann wirklich alle Forschenden aus dem Verbund zusammenkommen, tauschen wir die Ergebnisse aus und erklären sie einander. Und dann können die gewonnen Erkenntnisse in dieser interdisziplinären Gemeinschaft zusammengeführt werden.“ Das Projekt ist also ein gutes Beispiel für die hochschulübergreifende Zusammenarbeit im FCHM.
Darüber hinaus wird auch der wissenschaftliche Nachwuchs in das Projekt mit einbezogen und insgesamt 7 Doktorand*innen aus den genannten Bereichen in einem interdisziplinären Umfeld ausgebildet.
3D-Reichweitenmodulator für die schnelle Bestrahlung bewegter Tumore in der Partiketherapie
(a): CT des Patienten mit Tumor; (b): aus CT extrahierte Form des Tumors; (c): gedruckter 3D-Reichweitenmodulator; (d): gemessene Dosisverteilung nach Planung mittels Monte-Carlo-Verfahren
(Bildnachweis: THM)
Finanzierung des Projekts:
BMBF-Förderung von 2022-2025
Beteiligte FCMH-Hochschulen und Ansprechpersonen:
Technische Hochschule Mittelhessen: Prof. Dr. Klemens Zink
Philipps-Universität Marburg: Dr. Ulrike Theiß, geb. Schötz
Justus-Liebig-Universität Gießen: Prof. Dr. Raikumar Savai
Webseite: noch im Aufbau.
Alternativ gibt es Informationen über das Forschungsprojekt auf der Website EnArgus, dem Internet-Portal des Bundesministerium für Wirtschaft und Energie.