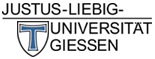Spotlight Infrastruktur: Das 3D-Druckzentrum der THM
Am 16. Januar 2023 wurde das neue 3D-Druckzentrum an der Technischen Hochschule Mittelhessen in der ehemaligen Schweißwerkstatt feierlich eröffnet. Die Mittel für das Projekt „3DP4E - 3D-Print 4 Everyone“ stammen aus der Förderlinie „Freiraum 2022“ von der Stiftung Innovation in der Hochschullehre (StIL). Das Zentrum bündelt vorhandene Ressourcen und Kompetenzen, um nachhaltiger mit Geräten und Materialien zu arbeiten. Zudem bietet es Studierenden, Mitarbeitenden und Forschenden an der THM niedrigschwellig die Möglichkeit zum „learning by doing“.
In einem eigenen Schulungsraum können Interessierte vor Ort von Grund auf an die Technologie herangeführt werden, um direkt im Anschluss nebenan mit dem FDM-3D-Druckverfahren und dessen Materialien zu experimentieren. Ihnen stehen dafür nicht nur einfache Geräte für das erste Kennenlernen zur Verfügung. Das Team des 3D-Druckzentrums um Christopher Butka und Marc-André Aghili Pour bietet darüber hinaus auch Druckverfahren mit hochwertigeren Materialien wie Nylonpulver oder Kunstharzen an. Damit lassen sich weitaus komplexere Projektideen umsetzen, die beispielsweise bei der Entwicklung von Prototypen, in der industriellen Produktion oder in der Medizintechnik eingesetzt werden können. Zur Ergänzung des Angebots stehen auch ein Lasercutter sowie ein sehr leistungsfähiger, tragbarer 3D-Scanner bei Bedarf zur Verfügung.
Foto: Eingang des 3D-Druckzentrums (Bildnachweis: THM)
Das Ziel des 3D-Druckzentrums ist es, insbesondere die theoretische und praktische Ausbildung an der THM im Bereich der additiven Fertigung ergänzend zum bestehenden Lehrangebot nochmals signifikant zu verbessern. Dafür können Lehrkräfte gemeinsam mit dem Expertenteam des Zentrums individuelle didaktische Konzepte erarbeiten, um die 3D-Druck-Technologie in ihre Lehrveranstaltungen einzubinden. Davon profitieren dann auch die Studierenden. Diesen wird zusätzlich durch die offene Werkstatt („Stu3Dy“) eine Möglichkeit geboten, eigene Ideen und Projekte im Rahmen problembasierten oder forschenden Lernens, beispielsweise für ihre Abschlussarbeit oder potenzielle Gründungsvorhaben, eigenständig umzusetzen.
Und wie Marc-André Aghili Pour deutlich macht, werden die vielfältigen Angebote des 3D-Druckzentrums bereits rege in Anspruch genommen: „Obwohl wir eigentlich erst mit Ende der Vorlesungszeit gestartet sind, wurden bereits mehr als 20Kg Druckmaterialien verbraucht und über 60 Personen geschult. Unsere Kapazitäten sind voll ausgeschöpft.“ Damit hat das Team die eigenen Zielvorstellungen nach nur zwei Monaten übertroffen. Mit dem großen Interesse seitens Studierenden habe man gerechnet ergänzt Christopher Butka. „Aber besonders positiv überrascht hat uns die hohe Nachfrage von Professorinnen und Professoren, die die Möglichkeiten des Druckzentrums für ihre Forschungsprojekte nutzen.“
Foto: Henrik Hoffmann, Christopher Butka und Marc-André Aghili Pour (v.l.n.r.) vom Team des 3D-Druckzentrums (Bildnachweis: THM)
Bislang steht das 3D-Druckzentrum nur Angehörigen der THM zur Verfügung, doch auch Forschende der anderen Hochschulen des FCMH können die Technologie des Zentrums für kooperative Forschungsvorhaben nutzen. So wurde beispielsweise erst kürzlich ein 3D-Modell eines NTCP-Rezeptors gedruckt für ein hochschulübergreifendes Kooperationsprojekt des LOEWE-Zentrums DRUID zur Erforschung und Bekämpfung von vernachlässigten tropischen Krankheiten. Dabei arbeiten unter anderem ein Team an der THM unter der Leitung von Prof. Dr. Denise Salzig mit der AG von Prof. Dr. Joachim Geyer an der JLU Gießen zusammen. Prof. Dr. Geyer erforscht die Hit-to-lead Entwicklung selektiver Hepatitis-D-Virus/Hepatitis-B-Virus (HDV/HBV) Entry-Inhibitoren, welche spezifisch den NTCP-Rezeptor blockieren, über den das Eindringen der Viren vermittelt wird. Das Team der THM von Prof. Dr. Denise Salzig entwickelt wiederum einen Prozess, um größere Mengen NTCP herzustellen, damit die AG von Prof. Dr. Geyer anschließend spezifische Tests mit Inhibitoren an den so erzeugten rekombinanten NTCP durchführen kann. Wie Prof. Dr. Denise Salzig erläutert, könne die Passgenauigkeit von Inhibitor und NTCP zwar auch bioinformatisch modelliert werden, „aber ein echtes Modell in 3D in den Händen zu halten, eröffnet oft ganz neue Ansatzpunkte bzw. Einsichten, warum gewisse Inhibitoren unter Umständen schon rein sterisch gesehen gut oder schlecht binden.“
Mehr Informationen zum 3D-Druckzentrum finden sich online auf der Website des Zentrums unter https://www.thm.de/3ddz/.
„Grundsätzlich legen wir viel Wert auf Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung. Deshalb arbeiten wir mit geschlossenen Systemen, die unverbrauchte Materialien auch direkt wiederaufbereiten können.“ - Marc-André Aghili Pour
Foto: 3D-Modell eines NTCP-Rezeptors (Bildnachweis: THM)