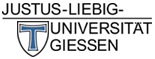Interviews mit Prof. Dr. Sangam Chatterjee und Prof. Dr. Boris Keil
Interview mit Prof. Chatterjee zur LOEWE-Transfer-Professur Hochtechnologiematerialien (HIMAT)
Im März 2024 erhielt der Gießener Physiker Prof. Dr. Sangam Chatterjee eine LOEWE-Transfer-Professur für Hochtechnologiematerialien (HIMAT) am Zentrum für Materialforschung (ZfM) und dem Fachbereich 07 – Mathematik und Informatik, Physik, Geographie der Justus-Liebig-Universität Gießen (JLU). Die Professur HIMAT stärkt die Anwendungsorientierung in der Materialwissenschaft und forciert insbesondere im Bereich moderner Beschichtungstechnologien die enge Kooperation mit der Wirtschaft. Das Land Hessen fördert diese Professur für fünf Jahre mit einer Million Euro aus Mitteln des LOEWE-Programms, die JLU steuert einen Eigenanteil in Höhe von rund 250.000 Euro bei.
Prof. Dr. Chatterjee, könnten Sie bitte kurz erläutern welche neuen Möglichkeiten Ihre LOEWE-Professur in Ihrer Forschungs- und Transferarbeit bietet?
Das zentrale Ziel meiner LOEWE Transfer-Professur HIMAT besteht in der Stärkung der Anwendungsorientierung in den Materialwissenschaften. HIMAT soll vor allem die Zusammenarbeit aus der Universität heraus mit externen Akteuren stimulieren. Dazu möchte ich gemeinsam mit ihnen Forschungsfragen aus den Hochtechnologien untersuchen. Dazu zählen sowohl die erneuerbaren Energien und die Energietechnologie genauso wie Elektronik und Halbleiter aber auch die Nanotechnologie und Nano-Photonik, die wir gemeinsam verbessern und systematischer vorantreiben wollen. Idealerweise initiiert die LOEWE Transferprofessur einen vertrauensvollen Dialog mit Unternehmens- bzw. Praxispartnern und identifiziert relevante Forschungsfragen frühzeitig, um so gemeinsam Lösungen zu erarbeiten.
Die finanzielle Unterstützung des Landes erlaubt es mir, ein kleines Team speziell für diese Transferbelange für fünf Jahren zu finanzieren. Das Team hat dann die Aufgabe, die speziellen Anforderungen der Industrie möglichst effektiv mit der universitären Forschung zu verknüpfen. So möchte ich Innovationen frühzeitig in die Realwirtschaft zur Anwendung und damit zur Verwertung bringen. Aus diesen Forschungsvorarbeiten für spezifische Anwendungsbereiche werden dann weitergehende gemeinsame Projekte initiiert. Hier versteht sich HIMAT über das Beispiel der konformen Beschichtungstechnologie durchaus als Technologiebrücke zur hessischen Wirtschaft und zur globalen Industrie.
Welche inhaltlichen Ziele verfolgen Sie im Rahmen der LOEWE-Transfer-Professur?
HIMAT nutzt moderne Beschichtungstechnologien, hier insbesondere die Atomlagenabscheidung (ALD), für gleichmäßige und homogene Beschichtung von komplexen Oberflächen. Dieses Verfahren ist in vielen Anwendungsbereichen überaus wichtig: für Pulvermedien in der Batterietechnologie oder im Maschinenbau oder etwa in der Halbleiterindustrie für die Herstellung von 3D-Strukturen und für die Mikroelektronik. Mittels ALD können etwa Materialien wie Metalle, Oxide und Nitride aufgetragen und damit Schichten mit unterschiedlichen elektrischen, optischen und mechanischen Eigenschaften hergestellt werden. Die Zielbereiche sind hier ganz unterschiedlich:
- Energiespeichermaterialien werden für Batterien und Super-Kondensatoren durch ALD optimiert, so werden die Leistungsfähigkeit der Energiespeicher verbessert und effizientere Lade- und Entladevorgänge ermöglicht.
- In der Halbleiterindustrie ist ALD entscheidend für die Herstellung von immer kleineren und leistungsfähigeren Mikrochips. Sie wird auch in der Produktion von Optoelektronik wie LEDs und Laserdioden sowie in der Sensortechnologie eingesetzt.
- Im Maschinenbau und beim Packaging schützen dünne, dichte Barriereschichten vor Feuchtigkeit, Sauerstoff oder anderen schädlichen Umwelteinflüssen.
- Optische Beschichtungen steigern die Effizienz von Solarzellen, indem sie die Reflexion von Licht minimieren und die Absorption von Sonnenenergie maximieren.
Gibt es Synergiepotenziale mit ihren anderen laufenden Forschungsprojekten?
Die Transferprofessur ermöglicht mir den anwendungsnahen Einsatz der hervorragenden Geräteinfrastruktur des EFRE-Innovationslabors „Hochleistungswerkstoffe“. Unter den Oberbegriff „Hochleistungswerkstoffe“ fallen zum Beispiel Materialien für die Batterietechnik, wie sie für den Exzellencluster Post-Lithium Storage (PoLiS) der JLU relevant sind oder auch Halbleiter, die eine immer größere Rolle in der Materialforschung hier spielen. Aus meiner Sicht bietet gerade die Halbleiterforschung hervorragende Anknüpfungspunkte zu vielen Kolleginnen und Kollegen an der JLU und innerhalb des FCMH. So können wir gemeinsam sowohl angewandte Forschung aber auch grundlegende Fragestellungen in Verbundprojekten verfolgen.
Grenz- und Oberflächenforschung betreibe ich schon seit mehr als einem Jahrzehnt. Über die genannten Aktivitäten an der JLU hinaus kann ich hier exemplarisch den Sonderforschungsbereich 1083 „Struktur und Dynamik innerer Grenzflächen“ unter Federführung der Philipps-Universität Marburg erwähnen, dem ich ebenfalls angehöre. Dieser ist ebenfalls Teil des gemeinsamen Campus-Schwerpunkts „Material, Molekül und Energie“.
Und welchen gesellschaftlichen Mehrwert kann ihre Forschung im Rahmen der LOEWE-Transfer-Professur bieten?
Die kooperativen Forschungsziele mit der Wirtschaft und innerhalb des FCMH habe ich bereits genannt, durch exzellente Forschung können wir aber vor allem exzellente „Köpfe“ für die Region gewinnen und sie auch langfristig als Fachkräfte hier binden, das ist mir wichtig. Hoch ausgebildete Fachkräfte sind schließlich eine der wichtigsten Grundlagen, um Produktions- und Entwicklungskapazitäten bei uns zu re-etablieren. Ich hoffe, mit HIMAT einen Beitrag zur „European Independence“ in der Energieversorgung zu leisten, um so etwa möglichen Rohstoffengpässen entgegenzuwirken.
Die LOEWE-Professur unterstützt meine Möglichkeiten der Hochtechnologieforschung über einen Zeitraum von immerhin fünf Jahren und ich bin zuversichtlich, dass wir mit der Unterstützung des Landes und in Kooperation mit externen Partnern langfristig tragfähige, verbesserte Strukturen für den Transfer in der Region erreichen werden.
Interview mit Prof. Boris Keil zur LOEWE-Transfer-Professur Brainmapping Technology
Anfang des Jahres 2024 erhielt Prof. Dr. Boris Keil eine LOEWE-Transfer-Professur "Brainmapping Technology“. Der Experte für bildgebende MRT-Verfahren vom Fachbereich Life Science Engineering der THM arbeitet an der Weiterentwicklung der Magnetresonanztomographie (MRT) zur hochpräzisen Abbildung des menschlichen Gehirns und Nervensystems. Das Land Hessen fördert diese Professur für fünf Jahre mit einer Million Euro aus Mitteln des LOEWE-Programms, die THM steuert einen Eigenanteil in Höhe von rund 200.000 Euro bei.
Prof. Dr. Keil, könnten Sie bitte kurz erläutern, was die LOEWE-Transfer-Professur „Brainmapping Technology“ eigentlich ist?
Die LOEWE-Transfer Professur „Brainmapping Technology“ schließt an meine langjährigen Arbeiten und Forschungen an. Sie hat zum Ziel, die Instrumente- und die Hardwareentwicklung, die wir hier in unseren Laboren generieren in die Wirtschaft und in klinische Prozesse zu transferieren. Das setzen wir im Rahmen des sogenannten Human Connectome Project um. Dieses Projekt wurde von der Obama-Administration als Fortsetzung des Human-Genome-Projekts der Clinton-Administration ins Leben gerufen, um mittels neuer technologisch translationaler Ansätze das Gehirn zu kartieren und seine Funktionsweise besser verstehen zu können. Unsere Arbeitsgruppe ist als einziges europäisches Wissenschaftsteam im Human Connectome Project beteiligt. Unsere Aufgabe ist die Entwicklung neue Hardware-MRT-Systemarchitekturen zur Aufnahme hochwertiger neuraler Gehirnbilddaten.
Welche neuen Möglichkeiten bietet Ihnen die neue LOEWE-Transfer-Professur?
Die Möglichkeiten, die die Transfer-Professur mir bietet, sind vielschichtig: Wenn wir in meiner Arbeitsgruppe unter normalen Bedingungen neue Hardware oder neue Instrumente im Bereich der Bildgebung oder Magnetresonanztomographie entwickeln, ist der Endpunkt unserer Forschung meist das Proof of Concept, welches wir publizieren. Das Ganze aber auf den Transferpfad zu bringen, knüpft also an dem Punkt an, an dem wir normalerweise aufhören. Grund hierfür ist, dass die Entwicklung innovativer Medizinprodukte mit hoher technologischer Komplexität, wie Kernspintomographie, oft deutlich herausfordernder ist als in manch anderer Branche. Das heißt, die geplanten Transferergebnisse müssen nicht nur technisch erforscht und realisiert, sondern auch klinisch erprobt werden. Dank der Förderung durch die LOEWE-Transfer-Professur schaffen wir eine Transfermanagementstelle an der Schnittstelle von Forschungsteam, Industrie und Klinik, um dieser besonderen Herausforderung zu begegnen.
Welche Ziele verfolgen Sie im Rahmen der LOEWE-Transfer-Professur?
Das Ziel der Transfer-Professur ist es nun, dass das Wissen, welches wir in unserer Forschung generiert haben, in anwendbare Produkte im ersten oder zweiten Gesundheitsmarkt mündet. Wir konzentrieren uns also darauf, das vorhandene jedoch noch aus vieler Hinsicht anwendungsferne Wissen der Connectome-MRT-Technologie in praxisrelevantes, unmittelbar anwendbares Handlungswissen zu überführen. Wir nutzen dazu ein Netzwerk aus Hochschule, klinischen Anwendern und Industrie. Auf diese Weise wollen wir die Lücke zwischen ersten bereits vorliegenden wissenschaftlichen Erkenntnissen hin zur wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Verwertbarkeit überbrücken.
Das langfristige Ziel ist es, die MRT-Technologie des Connectome-Scanners in ein zertifiziertes Medizinprodukt zu überführen. So soll diese Technologie in der klinischen Praxis breite Anwendung finden und der Gesellschaft zugutekommen. Als mittelfristiges Ziel sollen Teilentwicklungen, wie beispielweise Signaldetektoren, MR-Feld-Monitoring oder Gradiententechnologie praxisnah ausgekoppelt werden, um sie z.B. mit bestehenden klinischen MRT-Scannern kombinieren zu können.
Inwiefern profitiert die Wissenschaft von diesem Projekt und insbesondere Ihrer Forschung?
Der wissenschaftliche Mehrwert der Transfer-Professur „Brainmapping Technology“ ist zunächst anwendungsbezogen: Wir entwickeln neue Technologien, um bildgebende Verfahren dahingehend weiterzuentwickeln, die Datenaufnahmegeschwindigkeit zu erhöhen und gleichzeitig die Sensitivität zu verbessern. Zunächst kann damit die Grundlagenforschung weiter vorangetrieben werden, um grundlegende Fragen zur Funktionalität des menschlichen Gehirns zu entschlüsseln. „Brainmapping Technology“ soll es ermöglichen zu verstehen, wie Konnektivität im Gehirn funktioniert. Letztendlich sollen die verbesserten bildgebenden Verfahren dann aber auch in der Klinik zum Einsatz kommen. Mit der Transfer-Professur wollen wir also die Brücke schlagen, von der sehr anwendungsbezogenen Wissenschaft der Instrumentenentwicklung zur Grundlagenforschung in den Neurowissenschaften.
Und welchen konkreten gesellschaftlichen Mehrwert kann ihre Forschung im Rahmen der LOEWE-Transfer-Professur bieten?
Ein konkreter gesellschaftlicher Mehrwert der von uns entwickelten Technologien liegt noch in der Zukunft, denn wir stehen noch am Anfang unseres Projekts und dessen, was wir für möglich halten. Nach meinem Dafürhalten ist das Potenzial unseres Vorhabens sehr hoch: Wir tragen nicht nur dazu bei, ein neues Werkzeug zur Verbesserung der menschlichen Gesundheit zu entwickeln, sondern auch dazu, unser Gehirn auf neue Weise zu vermessen und so wahrscheinlich auch neues Wissen über uns als „geistige“ Menschen zu ermöglichen. Hier sehe ich auch eine Analogie zum damaligen Human Genome Project: Dieses begann ebenfalls als ein Grundlagenforschungsprojekt und ist heute so weit in der Gesellschaft angekommen, dass eigentlich die meisten Menschen etwas über Genetik wissen und zumindest ein grundlegendes Verständnis haben. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir auch vielleicht in 20 oder 30 Jahren ein breites gesellschaftliches Bewusstsein dafür schaffen können, wie Verbindungen im Gehirn funktionieren, was die Aufgabe der sogenannten Konnektoren im Gehirn sind und wofür wir dieses Wissen nutzen können.