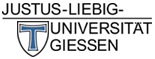Spotlight Forschungszentrum „Transformations of Political Violence" (TraCe)

Foto: Pixabay
Forschungszentrum "Transformations of Political Violence" (TraCe)
Was wollen Sie mit dem Projekt erreichen?
Mit TraCe bündeln wir die Kapazitäten der Friedens- und Konfliktforschung an verschiedenen hessischen Standorten und bauen die Zusammenarbeit zwischen den hessischen Hochschulen und der Hessischen Stiftung Friedens- und Konfliktforschung aus. Thematisch befassen wir uns zum einen mit Ansätzen und Bedingungen zur Beendigung und Überwindung politischer Gewalt. Zum anderen gehen wir der Frage nach, inwiefern neuere Trends sowohl in den internationalen Beziehungen als auch innergesellschaftlich dazu führen, dass bestehende Institutionen und Praktiken der Gewalteinhegung und des friedlichen Zusammenlebens in Frage gestellt werden. So hat beispielsweise der Internationale Strafgerichtshof in einigen afrikanischen Ländern an Glaubwürdigkeit verloren. Innenpolitisch lässt sich wiederum auch in liberalen Gesellschaften eine zunehmende Politisierung von Normen und kollektiver Identitäten beobachten. Dabei spielen neben offenkundigen politischen Zielen und Interessen auch Faktoren wie der technologische Wandel oder neue Formen der Legitimierung von Gewalt etwa gegenüber bestimmten gesellschaftlichen Gruppen oder durch diese eine zentrale Rolle. Ein besonderes Augenmerk richten wir zudem darauf, wie an vergangene – etwa kriegerische oder koloniale – Gewalt erinnert wird und welche Auswirkungen dies auf gegenwärtige internationale und gesellschaftliche Konflikte hat. Oft haben diese zu gesellschaftlichen Spaltungen geführt, die bis in die Gegenwart politische Prozesse bestimmen, Machthierarchien verstetigen und Verteilungskonflikte hervorbringen. Dass dies nicht nur innerhalb von Staaten, sondern auch global von Relevanz ist, zeigen die stetigen Forderungen ehemaliger Kolonien nach Aufarbeitung von und Entschädigung für Kolonialverbrechen ebenso wie die sich wandelnden normativen Rechtfertigungsmuster sowie situativen Veränderungen von Intervention und Interventionsverbot.
Welche Auswirkungen hat das Projekt auf die Forschung und Gesellschaft bzw. wie kann die Gesellschaft von Ihrem Projekt profitieren?
Wir versprechen uns durch TraCe Einsichten dazu, wie sich unter rasant verändernden globalen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen Konflikte so einhegen lassen, dass es nicht zu einer gewaltsamen Eskalation kommt. Offenkundig funktionieren bestimmte Institutionen und Praktiken der Gewaltprävention nur noch zum Teil. So ist die 2005 vereinbarte Schutzverantwortung zum Eingreifen in Situationen schwerer Menschenrechtsverbrechen und Brüchen des humanitären Völkerrechts aufgrund komplexer Konfliktsituationen und regionalen Interessenkonstellationen schwierig anzuwenden. Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine unterstreicht, dass es dringend einer Neuordnung der europäischen Sicherheitsarchitektur bedarf. Es geht uns dementsprechend darum, in der Forschung zu politischer Gewalt auf aktuelle Entwicklungen zu reagieren, unser Verständnis der Ursachen und Dynamiken politischer Gewalt zu erweitern und der Gesellschaft Möglichkeiten aufzuzeigen, was wirksam gegen Gewalt getan werden kann.
Worin sehen Sie den besonderen Nutzen in der hochschulübergreifenden Zusammenarbeit? Was ist das Besondere an Ihrem Projektteam?
Das Projekt bringt zum ersten Mal die in Hessen an unterschiedlichen Standorten vorhandenen Expertisen der Friedens- und Konfliktforschung zusammen. Dies ermöglicht eine Zusammenarbeit zwischen sozial-, geistes- und technikwissenschaftlichen Disziplinen, die es benötigt, um auf die Herausforderungen unserer Zeit zu reagieren. Politische Gewalt in all ihren Facetten ist ein Phänomen, das nur in einem interdisziplinären Kontext angemessen erforscht werden kann. TraCe bietet dafür die idealen Bedingungen. Eingebunden sind darüber hinaus eine ganze Reihe von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern in frühen Karrierestufen, so dass das Zentrum auch ein wichtiger Ort in Hessen für die wissenschaftliche Weiterqualifikation in einem interdisziplinären Umfeld sein wird.
Finanzierung des Projekts:
BMBF-Förderung von 2022-2026
Beteiligte FCMH-Hochschulen und Ansprechpersonen:
Principal Investigators Philipps-Universität Marburg: Prof. Dr. Felix Anderl, Prof. Dr. Thorsten Bonacker, Prof. Dr. Susanne Buckley-Zistel, Prof. Dr. Anika Oettler
Principal Investigators Justus-Liebig-Universität Gießen: Prof. Dr. Horst Carl, Prof. Dr. Thilo Marauhn, Prof. Dr. Stefan Peters, Prof. Dr. Monika Wingender
Weitere Partner: TU Darmstadt, Goethe-Universität Frankfurt, geleitet wird das Projekt von der Hessischen Stiftung Friedens- und Konfliktforschung
Webseite: https://www.trace-center.de/