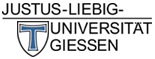Fünf Jahre Forschungscampus Mittelhessen – viele Gründe zu Feiern
Während die hochschulübergreifende Kooperation zwischen den drei mittelhessischen Hochschulen mittlerweile schon dreißig Jahre zurückreicht, hat der Forschungscampus Mittelhessen im November 2021 seinen fünften Geburtstag gefeiert. Dies haben wir zum Anlass genommen, 2022 mit einer Veranstaltungsreihe der Vielseitigkeit des FCMH Rechnung zu tragen und gemeinsame Erfolge zu feiern.
Den Startschuss gab die Podiumsdiskussion „Vordenken von Zukünften – wie wollen wir leben, forschen, arbeiten?“ vom 18. Mai 2022 an der Justus-Liebig-Universität Gießen. Nach einem moderierten Eröffnungsgespräch durch die Mitglieder des Direktoriums des FCMH, Prof. Dr. Thomas Nauss (UMR), Prof. Dr. Joybrato Mukherjee (JLU) und Prof. Dr. Matthias Willems (THM) sowie Grußworten der DFG-Präsidentin Prof. Dr. Katja Becker (vormals JLU) und der hessischen Wissenschaftsministerin Angela Dorn wurde das Thema des Abends in einer gehaltvollen Podiumsdiskussion vertieft.

- Die Hessische Ministerin für Wissenschaft und Kunst Angela Dorn, Prof. Dr. rer. physiol. Keywan Sohrabi (THM), Prof. Dr. Katja Fiehler (JLU), Prof. Dr. Anika Oettler (UMR) und Präsident der Von Behring-Röntgen-Stiftung und Vorstand der Volksbank Mittelhessen Dr. Lars Witteck diskutieren in einer Podiumsdiskussion das Thema „Vordenken von Zukünften – Wie wollen wir leben, forschen, arbeiten?“ moderiert von Dr. Jan-Martin Wiarda (v.l.n.r), Foto: Katrina Friese
Auf dem Podium diskutierten Ministerin Angela Dorn, Prof. Dr. Anika Oettler (UMR), Prof. Dr. Keywan Sohrabi (THM), Prof. Dr. Katja Fiehler (JLU) und Dr. Lars Witteck (Präsident der Von Behring-Röntgen-Stiftung, Vorstand der Volksbank Mittelhessen); Wissenschafts- und Bildungsjournalist Dr. Jan-Martin Wiarda moderierte die Diskussion. Der Abend diente dem Feiern, dem Erinnern, aber vor allem dem Blick in die Zukunft des Forschungscampus und der Region Mittelhessen. Prof. Willems lobte das in Deutschland einzigartige hochschultypübergreifende Promotionszentrum für Ingenieur-wissenschaften und die damit verbundene neue Möglichkeit der wissenschaftlichen Qualifizierung zum „Dr.-Ing.“ sowie die gemeinsame Nachwuchsförderung im Verbund insgesamt. Prof. Nauss hob die Bedeutung der Zusammenarbeit auch über die drei Hochschulen hinaus mit den außeruniversitären Partnern hervor. Durch diese Netzwerke entstünden „wertvolle Dynamiken und ein agiler Austausch,“ so Prof. Nauss. Prof. Mukherjee erinnerte an die ausschlaggebende Überlegung, mit welcher der Forschungscampus vor nun mehr als fünf Jahren gegründet wurde: „Wir wollen keinen kannibalistischen lokalen Wettbewerb untereinander, sondern eine Bündelung der Kräfte in der Region für den nationalen und internationalen Wettbewerb.“ „Gemeinsam können die Hochschulen mehr erreichen und Forschungs- und Arbeitsinfrastrukturen schaffen wie sonst nur in einer Metropolregion“, ergänzte Prof. Nauss.
Auch die an der Podiumsdiskussion beteiligten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zogen eine positive Bilanz über fünf Jahre FCMH und legten gleichzeitig ein Augenmerk auf die Zukunft und Weiterentwicklung des Verbundes. Prof. Oettler beschrieb eine Zukunft, in welcher der FCMH ein Best-Practice-Beispiel für die Forschungs- und Nachwuchsförderung ist. Einen größeren Frauenanteil in der Forschung forderte Prof. Sohrabi. Dr. Witteck sieht den FCMH schon heute als identitätsstiftend in der Region. Der FCMH habe „eine Vorbildfunktion“ in der interkommunalen Zusammenarbeit. Seine Aufgabe sei auch der Transfer, damit der »Schatz an Wissen«, welcher in den drei Hochschulen liegt, für die Region nutzbar wird.
In der ersten Folgeveranstaltung „Gesundheit im pandemischen und globalen Zeitalter“ am 21. Juni 2022 gaben Prof. Dr. Michael Knipper (JLU), Prof. Dr. Michael Kracht (JLU), Johannes Gehron (UKGM), Prof. Dr. Bernd Schmeck (UMR), Prof. Dr. Andreas Vilcinskas (JLU) und Niklas Köhler (THM) in kurzen „Science in Pictures“-Vorträgen Einblicke in ihre vielfältigen Forschungsthemen. Die Themen umfassten die Antibiotika-Forschung in Mittelhessen auch die medizintechnischen Entwicklungen in der Kinderheilkunde bis hin zum Einsatz von Naturstoffen zur Bekämpfung von Pandemien und Tropenkrankheiten. So legte Prof. Schmeck dar, was wir aus dem Wettstreit der Systeme, die bei Infektionen ins Spiel kommen, lernen können, während Prof. Knipper in seinem Vortrag über die Relevanz von globaler Gerechtigkeit im Bereich Gesundheit als eine wichtige Lehre aus der Pandemie zog, dass das Soziale mit dem Biowissenschaftlichen verbunden werden müsse. Einen Einblick in die Wirkstoff-forschung gab Prof. Kracht, der das das Potenzial des Naturstoffs Thapsigargin vorstellte. Ein Molekül, das aufgrund seines starken antiviralen Effekts möglicherweise als neues Medikament etwa gegen Coronaviren eingesetzt werden könnte. Niklas Köhler leitete über zur Medizintechnik und stellte ein Prototyp zur kontaktlosen Atemfrequenzanalyse von Kleinkindern mittels Kamera vor, den er in seinem Promotionsprojekt entwickelt. Johannes Gehron stellte ebenfalls das Zusammenspiel von Technik und Gesundheitsforschung in den Vordergrund und erläuterte, wie mittels eines Simulators des Blutkreislaufs die Konkurrenz des versagenden Herzens und künstlicher Kreisläufe untersucht und so die Therapie verbessert werden könne. Prof. Schäberle und Prof. Vilcinskas brachten den Anwesenden schließlich einige Erkenntnisse aus dem Bereich der Insektenbiotechnologie näher. Nämlich einerseits, wie invasive Stechmücken, welche Tropenkrankheiten übertragen, umweltfreundlich kontrolliert werden können, und andererseits, welche Mikroorganismen das Wachstum von Keimen hemmen und damit potenziell für die Antibiotikaforschung nutzbar gemacht werden können.
Unter dem Titel „Lebenswerte Zukunft im Klima und der Arbeitswelt von morgen“ fand am 21. Juli 2022 die zweite Folgeveranstaltung statt. Bei dem Netzwerk-Workshop erhielten Teilnehmende die Möglichkeit, sich mit Expertinnen und Experten, z. B. aus lokalen und regionalen Organisationen, aus Verbänden, Unternehmen, Aktionsbündnissen oder den Städteverwaltungen, den großen Fragen unserer Zeit zu widmen: Was ist noch ein Wetterumschwung und was schon Klimawandel? Wie wollen wir in Zukunft, in einer vom Klimawandel geprägten Welt gemeinsam leben, forschen, und arbeiten? Müssen wir unsere Städte, Arbeitsplatzorganisation, Hochschulen und gesamten Lebenswandel umdenken? Den Input und Stoff zur Diskussion gaben Prof. Dr. Jörg Bendix, Professor für Klimageographie und Umweltmodellierung (UMR), Prof. Dr.-Ing. Steffen Heusch, Professor für Wasserwirtschaft und Hydrologie (THM), Prof. Dr. Harald Platen, Professor für Umweltanalytik und Ökotoxikologie (THM), Prof. Dr. Simone Strambach, Professorin für Knowledge Dynamics, Sustainable Innovation and Global Change (UMR) und Dr. Elena Xoplaki, Akademische Rätin am Institut für Geographie und Zentrum für internationale Entwicklungs- und Umweltforschung (ZEU), Leiterin der AG Klimatologie, Klimadynamik und Klimawandel (JLU). Der deutliche Konsens der Forschenden, dass Klimaschutzmaßnahmen sowohl ländlich als auch urban in der Stadtentwicklung weitergedacht werden müssen, um auf zukünftige Extremwetterbedingungen, wie die beispielhafte Flutkatastrophe im Ahrtal 2021, vorbereitet zu sein, deckte sich mit den Stimmen der Teilnehmenden. National und international würden die Extreme nach Einschätzung der Forschenden zunehmen, so dass in nahezu allen Bereichen städtebauliche Anpassungen an den Klimawandel nötig sein werden. Auf Basis der kurzen Pitches zu ihren Forschungsprojekten vernetzten sich die Teilnehmenden im Anschluss, um Möglichkeiten der Zusammenarbeit in gemeinsamen Projekten zu besprechen.
Den Abschluss der Jubiläumsreihe bildete die dritte und letzte Folgeveranstaltung „Welche Rolle spielt Forschung in der Gesellschaft?“ am 29. September 2022. Drei Forschende und ein Gründungsteam erläuterten in Kurzvorträgen aktuelle Projekte und illustrierten die gesellschaftliche Relevanz ihrer gegenwärtigen Forschung. Prof. Dr. Stephan Becker, Leiter des Instituts für Virologie an der Philipps-Universität Marburg, sprach zum Thema „Bekämpfung von neu auftretenden Infektionskrankheiten“ unter anderem über die Wichtigkeit der erkenntnisgeleiteten Forschung, die die Grundlage für weiterführende angewandte Forschung bildet. Man könne nie vorhersagen, für welche Zwecke wissenschaftliche Entdeckungen im Endeffekt genutzt würden, so Prof. Becker, und brach so eine Lanze für die Grundlagenforschung ohne direkten Anwendungsbezug.
Prof. Dr. Boris Keil, Professor für Magnetic Resonance Imaging am Fachbereich Life Science Engineering der Technischen Hochschule Mittelhessen, der selbst Methoden und Technologien für die Magnetresonanztomographie entwickelt und baut, sprach in seinem Vortrag „Going Loopy: Meine Tesla-Sucht und der Einblick ins Gehirn“ über die Weiterentwicklung und Neuentwicklung von Methoden, um MRTs leistungsfähiger zu machen und damit mehr über das funktionelle und strukturelle Zusammenspiel des Gehirns zu erfahren. Prof. Keil stellte in diesem Zuge das „Human Connectome Projekt“ vor, einem internationalen Projekt, mit einem Research Consortium aus der Technischen Hochschule Mittelhessen, Siemens Healthineers, der Havard University und dem National Institutes of Health (NIH). Dieses Projekt hat zum Ziel, in interdisziplinärer Zusammenarbeit das Human Connectome zu entschlüsseln. Wenn die Forschungen abgeschlossen sind, sollen die Ergebnisse an die Medizinische Forschung übergeben werden, um neurofunktionelle Forschung direkt betreiben zu können und menschliche Verhaltensweisen besser kennenzulernen, Krankheiten zu verstehen und die die Methodik generell weiterzuentwickeln, was einen großen Erkenntnisgewinn großen gesellschaftlichen Vorteil zur Folge haben kann.
In anschließenden Vortrag „Osteuropaforschung: Umbrüche und Neuorientierungen angesichts des Kriegs Russlands gegen die Ukraine“ erläuterte Prof. Monika Wingender, Geschäftsführende Direktorin des Gießener Zentrums Östliches Europa (GiZo) und Professorin für slawische Sprachwissenschaft an der Justus-Liebig-Universität Gießen, die aktuelle gesellschaftliche Relevanz und die Rolle der Osteuropaforschung. Ihre Aufgabe sei es zu erforschen, zu erklären, zu informieren, aufzuklären und Lösungen vorzuschlagen. Frau Prof. Wingender schlug schließlich den Bogen zu medialen Vorwürfen eines Versagens der Osteuropaforschung und verwehrte sich gegen Aussagen der Medien, es sei in den vergangenen Jahren hauptsächlich Russlandforschung betrieben worden und das Nicht-Vorhersehen des Angriffskrieges sei mit einem Scheitern der Osteuropaforschung gleichzusetzen. Seit Kriegsbeginn am 24.2.2022 beschäftigt sich der Fachbereich … der JLU intensiv mit dem Wissenstransfer in die Gesellschaft, u.a. durch einen neu eingeführten Blog „Vom ‚Rande‘ zum Herzen Europas. Schlaglichter zur Geschichte der Ukraine“ (https://www.uni-giessen.de/fbz/zentren/gizo/aktiv/2022/blog) oder auf der Internetpräsenz der Hessischen Landeszentrale für politische Bildung, auf welcher Forscherinnen und Forscher auf Fragen zum Krieg antworten (https://hlz.hessen.de/themen/ukraine).
Prof. Wingender ging in ihrem Vortrag detailliert auf das sowohl in der Ukraine als auch in Russland bereits seit Jahren herrschende Spannungsfeld hinsichtlich der Sprachenfrage ein und erläuterte dem Publikum, wie beide Länder diese über viele Jahre instrumentalisiert und politisiert haben.
Zuletzt stellte Prof. Dr. Till Keller, Klinischer Leiter des Kerckhoff Herzforschungsinstituts mit der Justus-Liebig-Universität Gießen GGmbH, gemeinsam mit Joshua Prim, Promovend am Promotionszentrum für Ingenieurwissenschaften des FCMH, das gemeinsame Projekt „KardioIQ“ vor. Die Gründungsmitglieder legten in ihrem Vortrag „Künstliche Intelligenz in der Medizin – von der wissenschaftlichen Idee zum Produkt“ die durch ihre Forschung entwickelten, schnellen und präzisen algorithmischen Auswertungen von EKG-Aufnahmen mithilfe innovativer Technologien dar. Da aktuell für die sichere Diagnose zahlreicher Herzerkrankungen häufig bildgebende Verfahren wie eine Magnetresonanztomographie (MRT) notwendig sind, ist die Entwicklung von KardioIQ, wo mithilfe eines EKGs neben offensichtlichen Krankheitsbildern auch solche erkannt werden können, für die bisher eine MRT-Untersuchung notwendig war, eine enorme Zeitersparnis, die im medizinischen Bereich oft lebensrettend sein kann.
Abschließend diskutierten die Vortragenden untereinander und mit dem Publikum im Rahmen einer Podiumsdiskussion u.a. über die nötige Aufmerksamkeit der Politik hinsichtlich der präventiven Infektionsforschung, besonders nach den bisherigen Erfahrungen während der noch anhaltenden Corona-Pandemie und darüber, wie wichtig Wissenschaftskommunikation in die Gesellschaft beispielsweise hinsichtlich des Ukrainekriegs oder der Corona-Pandemie ist, um generell eine allgemeine Anerkennung wissenschaftlicher Wahrnehmung in der Gesellschaft zu festigen.
Wir danken allen Beteiligten für die gelungenen Veranstaltungen und die spannenden Diskussionen. Wir freuen uns auf die gemeinsame Zukunft des FCMH!