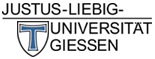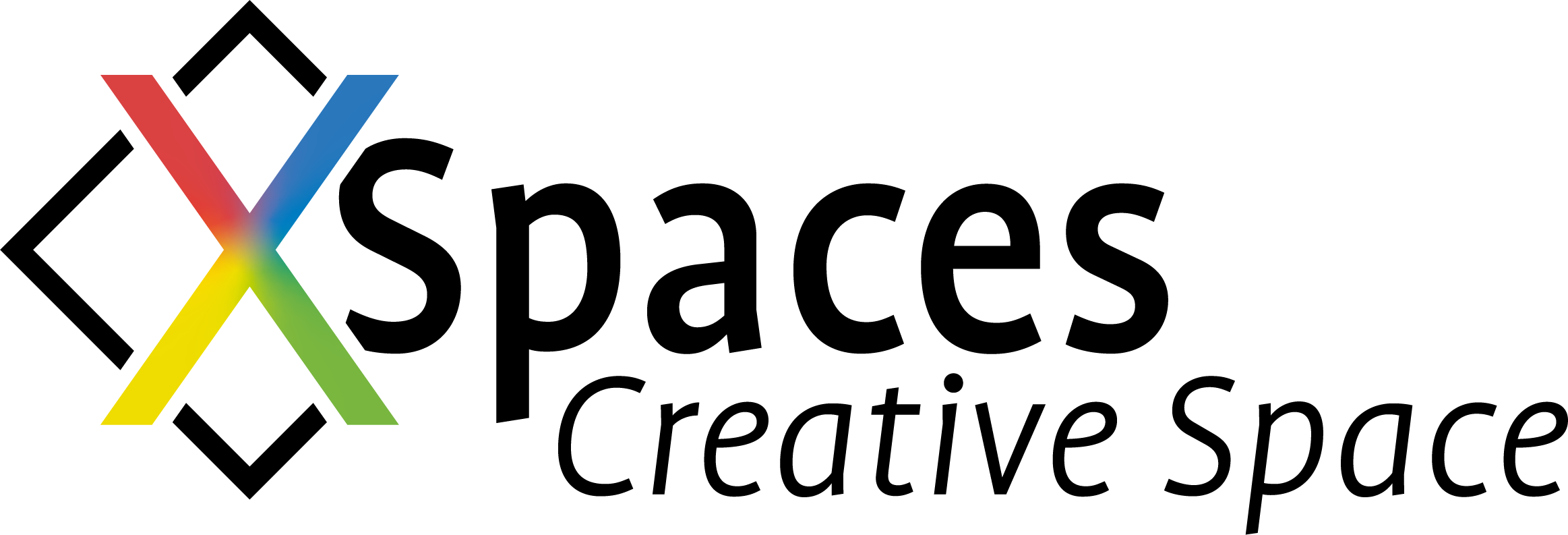PITCH-CONTEST „INNOVATIVE MINDS“ – ENTFESSELN SIE IHRE IDEEN!
- PITCH-CONTEST „INNOVATIVE MINDS“ – ENTFESSELN SIE IHRE IDEEN!
-

Pitch-Contest "INNOVATIVE MINDS" - entfesseln Sie Ihre Ideen!
Am 12. März 2025 findet der INNOVATIVE MINDS Pitch-Off im Rahmen der FCMH-Forschungsförderlinie "Experimentierräume" und der Creative-Space-Förderung der Universität Marburg im Lokschuppen in Marburg statt.
Der INNOVATIVE MINDS Pitch-Off bietet Ihnen die einzigartige Gelegenheit, Ihre kreativen Ideen einem breiten Publikum zu präsentieren, finanzielle Mittel für die Umsetzung zu erhalten und sich mit Forschenden aus verschiedenen Disziplinen zu vernetzen.
In dem Wettbewerb werden zwei Förderlinien zusammengebracht, um unterschiedliche Zielgruppen und Projektarten gleichermaßen zu unterstützen: Während sich die FCMH-Förderlinie “Experimentierräume“ an Forschende ab dem Postdoc-Level richtet und ausschließlich Projekte im Bereich Forschung fördert, unterstützt die Creative-Space-Förderung Promovierende und Postdocs bei der Umsetzung innovativer Vorhaben aus den Bereichen Forschung, Transfer und Wissenschaftskommunikation
3 Gründe, warum Sie Ihre Projektideen pitchen sollten:
1. Förderung: Die besten Forschungsprojektideen erhalten eine Förderung oder Anschubfinanzierung von bis zu 5.000 €.
2. Netzwerk: Finden Sie neue Kooperationspartner und erweitern Sie Ihr Projektteam um weitere Expertisen.
3. Training: Alle Teilnehmenden, die ihre Ideen pitchen, erhalten vorab (am 10. März 2025) ein professionelles Pitch-Training.
Wer kann seine Projektideen pitchen?
Der Pitch-Contest richtet sich an Promovierende, Postdocs, wissenschaftliche Mitarbeitende sowie Professorinnen und Professoren der FCMH-Hochschulen (Justus-Liebig-Universität Gießen, Philipps-Universität Marburg, Technische Hochschule Mittelhessen). Es können nicht nur ausgereifte Forschungsideen gepitcht werden, sondern auch Ideen im Anfangsstadium, zu denen beispielsweise auch noch weitere Projektbeteiligte gesucht werden, die das Forschungsteam interdisziplinär und hochschulübergreifend ergänzen.Wie funktioniert die Anmeldung, wenn ich ein Projekt pitchen möchte?
Sie können sich bis zum 24. Februar 2025 mit einer kurzen Beschreibung Ihrer Idee anmelden (siehe Link) Achtung: Da die Teilnehmerplätze limitiert sind, gilt das Windhundprinzip – je früher Sie sich anmelden, desto größer ist die Chance, dass Sie Ihren Pitch präsentieren können. Es findet keine Vorauswahl der vorgestellten Projekte statt.Da alle Teilnahmeplätze für die Pitches vergeben sind, ist derzeit nur noch eine Anmeldung auf der Warteliste möglich!
Kann ich auch teilnehmen, wenn ich selbst kein Projekt pitchen möchte?
Alle Interessierten sind herzlich zur Teilnahme eingeladen. Wir bitten um Anmeldung (siehe Link). Auch als Zuschauerin bzw. Zuschauer haben Sie die Möglichkeit, die Projektteams mit Ihrer Expertise zu unterstützen oder sich spontan Projektteams anzuschließen, wenn die Projektverantwortlichen ihr Team erweitern möchten. Hierzu sollten Sie bereits ab 13:30 Uhr an der Veranstaltung teilnehmen. Ab 16:45 Uhr sollten Sie dabei sein, wenn Sie den Wettbewerb verfolgen möchten. Ab dem 24.02.2025 werden auf dieser Seite alle Projekte vorgestellt, die am 12.03.2025 gepitcht werden.
Agenda der Veranstaltung:
13:30 Uhr: Registrierung
13:45 - 15:00 Uhr: Begrüßung und Erste Pitch-Runde (Möglichkeit zur Erweiterung der Projektteams)
15:00 - 15:30 Uhr: Kaffeepause und Networking
15:30 - 16:30 Uhr: Vertiefende Diskussionen in Breakout-Sessions
16:30-16:45: Pause
16:45 - 18:00 Uhr: Pitch der Projektideen
18:00 - 18:30 Uhr: Empfang und Get-Together, währenddessen Bewertung durch die Fachjury
18:30 - 19:00 Uhr: Preisverleihung und Ausklang
Sie möchten mehr über diese Veranstaltung erfahren? Nehmen Sie an einer unserer virtuellen Info-Lunches teil!
1. Info-Lunch: 09. Januar 2025, 12.30-13.30 Uhr (online) – Vorstellung des Veranstaltungsformats und Fragerunde
2. Info-Lunch: 4. Februar 2025 , 12.30-13.30 Uhr (online) – Vorstellung des Veranstaltungsformats und Fragerunde
3. Info-Lunch: 04. März 2025 , 12.30-13.30 Uhr (online) – Vorstellung des Veranstaltungsformats und Fragerunde
Hier sehen Sie nochmals in der Übersicht, wer die Zielgruppen der Förderformate sind, und welche Förderinhalte möglich sind.
Förderlinie Creative Space
Förderlinie Experimentierräume
Zielgruppe
- Promovierende und Postdocs der UMR sind antragsberechtigt – zusätzlich dürfen Promovierende/Postdocs/Professor*innen der beiden anderen FCMH-Hochschulen beteiligt sein
- Forschende aus mind. 2 verschiedenen Fachbereichen müssen beteiligt sein
- Forschende von mindestens zwei FCMH-Hochschulen müssen beteiligt sein
- Personen ab Postdoc-Level sind antragsberechtigt
Mögliche Förderinhalte
- Innovative Vorhaben aus den Bereichen Forschung, Transfer, Wissenschaftskommunikation können gefördert werden
- Innovative Forschungsvorhaben werden gefördert
- Outputformat: individuell (z.B. Publikation, Drittmittelantrag, Podcast)
Zu beachtende Hinweise
- Verausgabung und Abrechnung der Mittel muss bis 31.10.2025 erfolgt sein
- Finanzielle Fördermittel müssen innerhalb von 12 Monaten verausgabt werden
Muss ich mich auf eine der Förderlinien bewerben?
Nein, die Einteilung auf die Förderlinien wird durch die Projektverantwortlichen vorgenommen. Auch wenn zum Zeitpunkt der Pitch-Anmeldung nicht alle Kriterien erfüllt sind, können Sie Ihre Idee präsentieren. Die Projektteams können – müssen aber nicht- auch im Rahmen der Veranstaltung oder im Nachgang erweitert werden.
- Hier finden Sie eine Beschreibung der bereits angemeldeten Pitches. Einige der Teams sind auch noch offen für interdisziplinäre und hochschlübergreifende Verstärkung. Bei Interesse können Sie gerne mit den Vorab Kontakt mit den organisatorinnen aufnehmen oder sich einfach zur Veranstaltung anmelden.
- Projekt: Teilhabe an der Sport- und Bewegungskultur für sehbehinderte Menschen
- Projekt: Blockade langanhaltender Antikörperproduktion durch das Coronavirus- Spike-Protein: Mechanismen und pharmakologische Ansätze
-
Im Einklang mit der CRPD geht es darum, Barrieren beim Zugang zu Sport & Bewegung für blinde & sehbehinderte Menschen abzubauen und die volle Teilhabe an der Sport- und Bewegungskultur zu ermöglichen (Build dowm barriers in PE & PA in CWVI). Um Barrieren & Gelingensbedingungen zu identifizieren, wurden in der sportpädagogischen Inklusionsforschung bisher insbesondere die Stimmen von Eltern, Lehrkräften/Trainer:innen oder weiteren Steakholdern erfasst. Die Stimmen der Betroffenen sind in der Forschung paradoxerweise unterrepräsentiert, obwohl gerade diesen Stimmen eine spezifische und für den Forschungsprozess unverzichtbare Dignität zukommt. Vorliegende Studien, in denen explizit sehbehinderte und blinde Menschen zu Wort kommen, fokussieren subjektiv rekonstruierte Teilhabebarrieren von Schüler:innen im Sportunterricht in unterschiedlichen Schulkontexten. Im Diskurs fehlen bisher Studien, die den Stimmen von zentralen sportlichen Vorbild Gehör verschaffen (sog. supercrips). Vor diesem Hintergrund ist es das Ziel des Projekts, der Stimme von Andy Holzer Gehör zu verschaffen, der sich selbst als blind climber bezeichnet und als professioneller Bergsportler als einer von zwei blinden Menschen den Mount Everst besteigen konnte. Um Andys subjektive Perspektiven auf Sport, Behinderung und Inklusion zu erfassen, findet ein partizipativer und multi-sensorischer Forschungsansatz Anwendung, um Interviewdaten in der Bewegung und am Berg unter Einbeziehung von Andy zu erheben.
Projektteam: Prof. Martin Giese, Philipps-Universität Marburg, Sport- und Bewegungspädagogik; Prof. Dr. Michaela Timberlake, Justus-Liebig Universität Gießen, Institut für Förderpädagokik und inklusive Bildung
-
Impfungen gegen und Infektionen mit Coronaviren führen nicht zur Differenzierung langlebiger Plasmazellen aus B-Zellen. Diese Plasmazellen sind notwendig zur Produktion hochspezifischer Antikörper und vermitteln eine langfristige Immunität. Es ist unklar, wie Coronaviren die Differenzierung in Plasmazellen aushebeln.
Die Impfung mit dem Spike-Protein von SARS-CoV2 rekapituliert dieses
Problem: Die von T-Zellen vermittelte Abwehr bleibt, jedoch werden mangels Plasmazellen langfristig keine Antikörper produziert. Erneute Infektionen sind möglich. Diese Beobachtung zeigt, daß das Ausbleiben der Plasmazell-Differenzierung eine Funktion des Spike-Proteins ist.
In diesem Projekt soll aufgeklärt werden, über welche zellulären Signalwege das Spike-Protein in den Differenzierungsvorgang eingreift und wie dies durch Wirkstoffe verhindert werden kann. So könnte das Ziel erreicht werden, Infektionen durch SARS-CoV2 und andere, Erkältungen verursachende Coronaviren dauerhaft zu vermeiden.
Das Projekte ist noch offen für die Beteiligung weiterer Projektpartner.
Projektteam: PD Dr.rer.nat. Till Adhikary; Philipps-Universität Marburg, Zentrum für Tumor- und Immunbiologie
- Projekt:First Genome-Scale Metabolic Modeling for Understanding HMPV-Host Interactions
- Projekt: Virtual Reality in der Palliativmedizin
-
A recent rise in flu-like cases in China has raised concerns about human metapneumovirus (HMPV). However, experts stress that HMPV is not new and differs from COVID-19. It mainly causes mild respiratory infections but can lead to severe illness in young children, older adults, and people with weakened immune systems.
HMPV spreads through respiratory droplets and poses a major financial burden on healthcare systems. In the U.S., it leads to around 20,000 hospitalizations annually, costing thousands per patient. No vaccine or specific treatment exists, as researchers still don’t fully understand how the virus interacts with human cells.
To address this, we propose a computational model to study how HMPV alters human metabolism. Since viruses rely on their host's resources, mapping these interactions could identify weak points in HMPV’s life cycle. Using flux balance analysis (FBA), we will compare healthy and infected cells in silico to uncover potential antiviral targets and support drug development.
This research aims to provide insights that could lead to new treatment strategies and improved healthcare responses to HMPV.
Projektteam: Dr. Reihaneh Mostolizadeh, Justus Liebig University Giessen, Department of Bioinformatics and Systems Biology; Prof. Bernd Schmeck, Philipps-University Marburg, Dept. of Respiratory and Critical Care Medicine
-
In der Palliativmedizin ist das primäre Ziel der Behandlung eine Verbesserung der Lebensqualität bei terminal erkrankten Menschen zu erzielen. Hierzu gehört neben einer medizinischen Behandlung im Sinne einer guten Symptomkontrolle auch psychosoziale Unterstützung und spirituelle Begleitung. Zumeist sind Menschen in der letzten Lebensphase körperlich stark eingeschränkt und können nicht mehr am "normalen" Leben teilhaben. Mit Hilfe von Virtual Reality (VR) möchten wir versuchen, die Lebensqualität der Betroffenen zu verbessern, in dem wir ihnen die Möglichkeit bieten, das Krankenzimmer für eine Zeit zu verlassen und sich mit Hilfe immersiver Technologie auf eine Reise zu begeben, die sonst nicht mehr möglich wäre. Mit Hilfe von VR können die Teilnehmenden an Orte gelangen, die sie sonst nicht mehr erreichen könnten. Wir erhoffen uns durch diese Form der Behandlung die Lebensqualität der schwer erkrankten Patienten zu verbessern und diese Veränderung wissenschaftlich darstellen zu können.
Projektteam: PD Dr. Christian Volberg, Philipps-Universität Marburg, Universitätsklinikum, Palliativmedizin; Prof. Dr. Ivica Grgic; Dr. Philipp Russ
- Projekt: SHYPEGermany – Multizentrische Studie zu Spontanhypoglykämien
- Projekt: Bakterielle Stoffwechselprodukte im Kampf gegen Blutkrebs
-
Spontanhypoglykämien sind Unterzuckerungen ohne Einfluss von Insulin oder insulinsteigernden Substanzen. Diese seltenen Zustände können auf lebensgefährliche Erkrankungen hinweisen, doch oft bleibt die Ursache unklar. Besonders herausfordernd: Die Symptome überschneiden sich mit psychiatrischen und psychosomatischen Beschwerden.
Von 2020 bis 2023 untersuchte die SHYPE-Studie erstmals interdisziplinär sowohl hormonelle als auch psychosomatische Aspekte dieser Patienten. Die Ergebnisse zeigten, dass viele Betroffene ohne organische Ursache unter bislang unerkannten psychischen Erkrankungen leiden. Dieser innovative Forschungsansatz, entwickelt von der Endokrinologie und der Psychosomatischen Medizin in Marburg, ist europaweit einzigartig.
Das Projekt wurde 2024 mit einem Posterpreis der Deutschen Gesellschaft für Endokrinologie ausgezeichnet. Um belastbare Rückschlüsse für die Patientenversorgung zu ziehen, planen wir nun eine multizentrische Studie. Dafür suchen wir Unterstützung, um dieses seltene, aber bedeutende Phänomen weiter zu erforschen.
Projektteam: Bente Nagel, Endokrinologie UKGM Marburg, Philipps-Universität MarburgJan Adelmeyer und Peter Herbert Kann; Zentrum für Endokrinologie Tobias Geisel, Kristina Islinger, Julia Moos, Johanna Berwanger, Johannes Kruse; Klinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie Universitätsklinikum Marburg und Giessen GmbH, Philipps-Universität Marburg Hanna Kampling, Johannes Kruse; Klinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie Universitätsklinikum Marburg und Giessen GmbH, Justus-Liebig Universität Giessen Peter Herbert Kann; German Center for Endocrine Care (DEVZ), Frankfurt am Main
-
Wechselwirkungen zwischen den Darm besiedelnden Bakterien und dem menschlichen Organismus sind bereits seit vielen Dekaden Gegenstand wissenschaftlicher Forschung. Bakterielle Stoffwechselprodukte (Metabolite) zeigen nachweislich immunmodulierende Effekte und können damit die Immunabwehr entscheidend beeinflussen. Im Rahmen der Infektiologie sind sie daher bereits Ansatzpunkt neuartiger Verfahren wie z.B. Stuhltransplantationen zur Heilung von Clostridium-difficile-Infektionen.
Das Immunsystem spielt allerdings gleichfalls sowohl in der Verhinderung als auch der Entwicklung von Tumorerkrankungen eine folgenschwere Rolle. Welche Bedeutung bakterielle Metabolite in diesen Prozessen spielen, ist bisher nicht verstanden. Durch unsere aktuellen Behandlungsstandards für Tumorpatienten greifen wir allerdings umfassend in das bakterielle Milieu und damit folglich auch in unser Immunsystem ein, ohne jedoch die Konsequenzen für die Tumorkontrolle abschätzen zu können.
Das vorliegende Forschungsprojekt möchte diese wissenschaftliche Lücke schließen. Es beschäftigt sich mit der Erforschung von bakteriellen Stoffwechselprodukten im Rahmen von Tumortherapien, insbesondere bei Blutkrebs (Leukämien). Hierzu soll zunächst eine breite Analyse von Blutproben von Blutkrebspatienten bezüglich bakterieller Metabolite erfolgen. Schließlich sollen Stuhlproben analysiert werden, um spezifische Bakterienstämme als Urheber der Immunmodulation innerhalb der Tumortherapien zu identifizieren und neuartige Therapieansätze zu entwickeln.
Projektteam: Dr. Theresa Weber, UKGM Marburg; Paul Weiland, M.Sc., Center for Tumor Biology and Immunology (ZTI) Prof. Andreas Burchert, Klinik für Hämatologie, Onkologie und Immunologie, UKGM Marburg
- Projekt: Nähe, Menschlichkeit und Begleitung in der modernen Patientenversorgung
-
In der modernen Patientenversorgung fehlt oft eines: Zeit für persönliche Zuwendung. Ärztinnen, Ärzte und Pflegekräfte geben ihr Bestes, doch der stressige Klinikalltag lässt wenig Raum für ein offenes Ohr, eine extra Erklärung oder einfach etwas Ablenkung vom monotonen Krankenhausleben. Gerade schwer kranke Patientinnen und Patienten, die Wochen oder sogar Monate in der Klinik verbringen, brauchen mehr als nur medizinische Versorgung – sie brauchen Menschlichkeit, Nähe und manchmal auch ein Lächeln. Früher waren es die „Grünen Damen“, die genau das ermöglichten. Heute möchten wir eine neue Generation ausbilden: Medizinstudierende als Clinic-Clowns und Patientenbegleiter. Clinic-Clowns bringen Leichtigkeit in den Klinikalltag, schenken Momente der Freude und sorgen für bunte Abwechslung. Patientenbegleiter sind einfach da – für Gespräche, kleine Besorgungen oder um letzte Wünsche zu erfüllen. Doch die große Frage ist: Hilft das wirklich? Während es zahlreiche Studien zur Wirkung von Clowns in der Kinderheilkunde gibt, fehlt eine wissenschaftliche Grundlage für erwachsene Patientinnen und Patienten. Wir wollen untersuchen: - Wie nehmen schwer kranke Erwachsene Clowns und Begleiter an? - Welche Form der Unterstützung ist sinnvoller? - Sollte man beides kombinieren – oder brauchen Patientinnen und Patienten vor allem Ruhe? Aktuell läuft bereits ein Pilotprojekt auf der hämato-/onkologischen Station 331 der Uniklinik Marburg. Unser Ziel ist es, mehr Menschlichkeit in die Behandlung und Begleitung schwer kranker Menschen zu integrieren.
Das Projekt ist interessiert an einer hochschulübergreifenden Kooperation.
Projektteam: Dr. Tillmann Rusch, Uniklinikum Marburg; Klinik für Hämatologie, Onkologie und Immunologie; PD Dr. med. Christian Volberg, Uniklinikum Marburg, Klinik für Anästhesie, Oberarzt Palliativstation; Dr. med. Jorge Riera, Uniklinikum Marburg, Klinik für Hämatologie, Onkologie und Immunologie, Leiter der Palliativstation, Oberarzt hämato-/onkologische Ambulanz
- Projekt: Airway EVs: Regulators of Organ Crosstalk (AERO) – Wie Lungeninfektionen das Gehirn beeinflussen.
- Projekt: Hirntumore und GABA im Tumormikromileu
-
Die Lunge und das Gehirn sind eng miteinander vernetzt und beeinflussen sich gegenseitig. So ist bekannt, dass Lungenerkrankungen neurologische Symptome hervorrufen können – ein Phänomen, das sich eindrücklich bei Long-COVID zeigt. Auch Infektionen wie bakterielle Lungenentzündungen stehen mit einem erhöhten Risiko für neurodegenerative Erkrankungen wie Morbus Parkinson in Verbindung. Doch die zugrunde liegenden Mechanismen sind bisher unverstanden. AERO erforscht, wie extrazelluläre Vesikel (EVs) aus Immunzellen der Lunge und bakteriellen Krankheitserregern entzündliche Botenstoffe ins Gehirn transportieren. Wir vermuten, dass diese EVs Immunzellen des Gehirns, sogenannte Mikrogliazellen, aktivieren und so neuroinflammatorische Prozesse auslösen. Mit modernsten Methoden – darunter Zellkulturen mit Lungen- und neuro-glialen Zellen sowie molekulare Hochdurchsatzanalysen – wollen wir aufklären, wie Lungeninfektionen die Gehirnfunktion beeinflussen. Diese Erkenntnisse könnten neue therapeutische Zielstrukturen aufzeigen und zur Entwicklung innovativer Diagnoseverfahren beitragen. AERO leistet einen wichtigen Beitrag zum Verständnis der Lungen-Gehirn-Kommunikation und könnte neue Perspektiven für die Behandlung infektiologischer und neurologischer Erkrankungen eröffnen.
Projektteam:Dr. Anna Lena Jung, Institut für Lungenforschung, Fachbereich Medizin, Philipps-Universität Marburg; Prof. Christoph Rummel (Institut für Veterinärphysiologie und Biochemie, Justus-Liebig-Universität Gießen)
-
Maligne Erkrankungen des ZNS wie das Glioblastom oder Hirnmetastasen z.B. von
Brust- und Lungenkrebs stellen eine erhebliche therapeutische Herausforderung dar.
Trotz intensiver Forschung und therapeutischen Interventionen sind die
Überlebensraten weiterhin niedrig, da viele molekulare Mechanismen, die das
Wachstum und die Metastasierung im Gehirn fördern, noch nicht vollständig
verstanden sind. Eine wichtige Rolle könnte dabei der Neurotransmitter Gamma-
Aminobuttersäure (GABA) spielen. Während GABA als hemmender Signalstoff im
zentralen Nervensystem bekannt ist, zeigen neuere Erkenntnisse, dass Tumorzellen
das GABAerge System für ihr eigenes Wachstum nutzen können. In unserer
Forschung untersuchen wir, wie sich GABA auf den Metabolismus von Tumorzellen
auswirkt und Progression sowie Therapieantwort beeinflusst. Dazu analysieren wir die
Expression von GABA-Rezeptoren und -Transportern in Glioblastomen und
Hirnmetastasen und erforschen, wie Tumorzellen auf verschiedene GABAKonzentrationen
reagieren. Dabei verwenden wir Proben aus der hauseigenen
neurochirurgischen Klinik, um klinisch relevante Erkenntnisse zu gewinnen. Unser Ziel
ist es, neue therapeutische Ansätze zu entwickeln, die gezielt in diese Signalwege
eingreifen, um das Tumorwachstum zu hemmen und möglicherweise die Effektivität
bestehender Therapien zu verbessern.
Projektteam: Dana Hockling, Neurochirurgie, Philipps-Universität Marburg
- Weitere Informationen und Kontakt
-
Dies ist eine Veranstaltung der Geschäftsstelle Forschungscampus Mittelhessen (FCMH) und des Projekts Creative Space (UMR).
Bei Fragen zur Veranstaltung können Sie sich sehr gerne an Vera Volkmann wenden:
E-Mail: Vera.Volkmann@fcmh.de Telefon: +49 (0) 641 99-16486
oder an Velia Benthin:
Telefon: +49 (0) 6421 28-23908